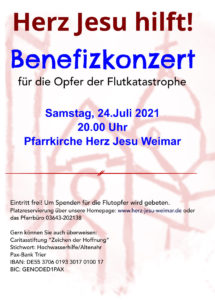Am Freitag, dem 16. Juli 2021 hat Papst Franziskus ein Motu Proprio mit dem Incipit „Traditionis Custodes“ erlassen. Darin hebt er explizit das Motu Proprio seines Vorgängers, Benedikt XVI, aus dem September 2007, „Summorum pontificum“, das Messen im vetus ordo ausdrücklich wieder für alle interessierten Gläubigen ermöglichte, auf. Und er fordert die „Hüter der Tradition“ (so die Übersetzung des Texttitels), also die Ortsbischöfe auf, nur noch unter sehr restriktiven Umständen die weitere Zelebration in dieser Form zuzulassen. Zusammen genommen mit dem weltweit nicht nur als harsch und ungerecht, sondern als wirklich grausam empfundenen Begleitbrief wird deutlich, daß sich in Rom für den Moment diejenigen durchgesetzt haben, die die ‘Alte Messe’ hassen und ihr Absterben wünschen.
Umfragen im Vorfeld, die diese Entscheidung motiviert haben sollen, blieben bisher unveröffentlicht, so daß nur Gerüchte die Runde machen, welche Stimmen aus welchen Ländern den Papst vor allem zu diesem Schritt bewogen haben mögen, der so viele Gläubige derzeit ihrer Fassungslosigkeit überläßt.
PuLa bedauert die Entwicklung sehr und sieht darin gerade nicht den behaupteten Weg zu einer größeren Einheit der Kirche. Aber man hörte ja auch zu Regierungszeiten Benedikts XVI. bereits, daß der Papst unter Druck stehe – ein Druck, dem er acht Jahre lang standhielt und schließlich zurücktrat.
Schon dieser Rücktritt hat besonders Gereon damals sehr mitgenommen und wir haben daraufhin drei aufeinander aufbauende Erzählungen unserer Wundersdorfer Freunde für Sie, liebe Leserschaft, niedergeschrieben. Heute und in den folgenden beiden Tagen möchten wir Ihnen diese Sketche aus gegebenem Anlaß in der Reihe PuLa Reloaded in Erinnerung rufen.
(Wie immer spiegeln die originalen Texte natürlich auch unsere damalige Situation vor Ort wider.)
Freuen Sie sich daher heute auf “Das Gleichnis. Eeine Fischergeschichte”, morgen auf “Der Fang. Eine Fischergeschichte” und übermorgen auf “Die unerhörte Kunde”!
Cornelie Becker-Lamers & Gereon Lamers
Und wenn wir Ihnen auch heute mit diesen Geschichten ‘Viel Vergnügen’ wünschen, dann meinen wir das ganz ernst, trotz der durch dieses unselige Dokument nochmals verschlimmerten Lage, in der die Kirche sich befindet.
Der ‘Liturgische Bürgerkrieg’ der damit völlig ohne Not erneut vom Zaun gebrochen wurde, wird selbstverständlich Anfang des 21. Jahrhunderts noch viel weniger, sehr viel weniger!, als vor 50, 60 Jahren das Ende der Messe in ihrer ehrwürdigen, überlieferten Form herbeiführen! Aber dieser “Krieg” wird nicht bloß viel Leid bringen, nein, er wird vor allem viel Kraft an der ganz falschen Stelle binden, denn, worauf gerade Kardinal Zen auf seinem Blog hingewiesen hat, das eigentliche Problem ist doch, daß die Menschen nicht mehr in die Messe gehen, egal in welche Form!
Und wer meint, in dieser Lage (die Mitte der Sechziger-Jahre so nur von ganz wenigen, wie einem gewissen Joseph Ratzinger, z.B., geahnt wurde) könnten wir es uns leisten, weltweit den wohl jüngsten!, eifrigsten, ja feurigsten Teil der Kirchenbesucher zu Bürgern zweiter Klasse zu erklären, dem kann ich wirklich nicht mehr helfen – und wenn er der Papst wäre.
Gereon Lamers
Aber jetzt, Enjoy: 🙂
Das Gleichnis, eine Fischergeschichte
(1. März 2013)
Den gestrigen sehr emotionalen Tag habe ich versucht zu verbringen, wie es sich für einen katholischen Blogger ziemt: Erst den Abflug von Papst Benedikt aus dem Vatikan per Twitter verfolgt (und wer immer meint, ein solch technisches Medium eigne sich nicht, Emotionen hervorzurufen, hat es nur noch nicht mit dem richtigen Anlaß versucht: Der letzte Benedikt-Tweet von 17.00 Uhr war herzerreißend…), dann in die Messe im Erfurter Dom ab 18.00 Uhr. Ein ordentliches Pontifikalamt mit allen „verfügbaren“ Geistlichen, die Predigt hat unser Altbischof Dr. Wanke gehalten.
Erfreulicherweise war ich lange nicht das einzige Weimarer Gemeindemitglied, das offenbar das Bedürfnis verspürte, an diesem Abend nicht allein zu sein, sondern im Kreis anderer Glaubender an den scheidenden Papst zu denken und ihm zu danken.
Freilich, es blieb einem Weimarer Katholiken mit diesem Wunsch auch nicht viel anderes übrig, denn einen besonderen Gottesdienst in unserer Pfarrkirche gab es nicht. Warum auch, ist ja nur der Papst, wenn man schon nicht hingeht, wenn er kommt, warum was machen, wenn er geht? Nur so nebenbei: In anderen (kleineren) Thüringer Gemeinden gab es solche besonderen Messen sehr wohl! Ach, Sie meinen, auf der Homepage stehe auch nichts? Ja, das stimmt, da ist man hier konsequent. Anderswo in der mitteldeutschen Diaspora sei das aber anders? Ja, das stimmt wohl auch!
Naja, bevor wir in Melancholie versinken, dem emeritierten Papst geht es gut, er liest, wie man hört, Urs v. Balthasar und das letzte, was er sich von uns wünschen wird, wäre Passivität, nicht wahr?
Daher beginnen wir heute auf PuLa ein neuartiges Format: Literarische Texte, die in einer Reihe aufeinander aufbauen. Freuen Sie sich auf einen ganz besonderen Besuch in Wundersdorf…
GL
Das Gleichnis
Ein Sketch für zwölf Fischer und einen Mönch
Wundersdorf im Oderbruch. – Halt! Falsch! Die Stelle, an der einmal das Haus Markt 6 in Wundersdorf/ Oderbruch stehen wird. Direkt neben der Durchreiche zur Küche. An einer seichten Stelle der Stobrava (heute der Stobber geheißen) sitzen im Kreis Faske, genannt der Starke, außerdem Balyschk und Jander, der kleine Jelatz, Halatze und Gulicke, die beiden Milchgesichter, Kalatz und Tzizik, Kosse, Loske und der eitle Krull. Sie alle fristen ihr Leben durch Fischerei und gehören zum Stamm der Liutizen, und Faske der Starke war selbst dabei, als man im großen Wendenaufstand die verhaßte ottonische Herrschaft abschüttelte, die Bischöfe von Havelberg und Brandenburg vertrieb (die fürderhin als sogenannte Titularbischöfe ihr Leben außerhalb Ihrer Besitzungen zubringen mußten) und dem „germanischen Spuk“ ein für allemal ein Ende gemacht zu haben glaubte…
Mit anderen Worten: Man schreibt das 22. Jahr der glorreichen Regierungszeit Drahomírs des Befreiers.
Wie bitte? Ach so: Für uns Christen gesagt, das dritte Jahr der Regierungszeit Heinrichs II.
Na gut, na gut: Das Jahr des Herrn 1005.
Es sitzen also elf sehnige Fischer um ein Lagerfeuer und lauschen den klugen Worten eines hageren Mönchs. Der Merten hat nämlich bleiben dürfen, damals, als man die Christen eigentlich alle rausgeschmissen hat. Der Merten hat bleiben dürfen, weil er so schöne Geschichten kennt, immer Streit schlichtet und außerdem total gut mit Pferden kann. Etwas abseits übrigens, aber nicht minder beteiligt Selmer, ebenfalls Fischer, aber ein bißchen anders als die andern.
Merten: Da lagen also zwei Boote am Ufer, und weil so viele Menschen hören wollten, was er sagt, stieg Jesus in eins der Boote und unterrichtete sie vom Wasser aus.
Kosse: Und er trieb nicht ab?
Merten: Nein. Er trieb nicht weiter ab, sondern kam wieder an Land und sagte dann zu Simon, er soll nochmal rausfahren ins tiefe Wasser und die Netze auswerfen.
Jelatz: Aber sie haben doch die Netze gerade schon saubergemacht.
Merten: Du hast gut aufgepaßt, Jelatz. Genau das sagte Simon auch: Wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen.
Balyschk: Und dann?
Merten: Dann sind sie natürlich doch rausgefahren, weil ja Jesus es gesagt hatte, und siehe da: Sie haben so viele Fische gefangen, daß sie dachten, die Netze halten nicht.
Gulicke: Ou! Das ist ganz gefährlich! Das ist meinem Großvater mal …
Die andern Fischer: Pscht!!!
Tzizik: Das hast du uns schon tausendmal erzählt!
Merten: Sie haben die Freunde im andern Boot zu Hilfe gerufen und haben dann die Netze in beide Boote ausgelehrt und da waren beide Boote so voll bis zum Rand, daß sie fast sanken.
Gulicke (brummelt leise vor sich hin): Wie bei meinem Großvater …
Loske: Ach! Das wünsch ich mir auch mal! So viele Fische, daß man sie kaum heimschleppen kann!
Halatze: Einmal richtig satt zu essen!
Merten: Wer weiß? Vielleicht hat es auch sein Gutes, daß man nicht von allem zu viel hat?
Faske (poltert los): Was soll das denn heißen?
Merten: Vielleicht kommt eine Zeit, in der die Menschen so viele Fische fangen, daß sie wieder welche ins Meer zurückwerfen?
(Die Fischer schütten sich aus vor Lachen.)
Balyschk: Hör mal, du Mönch, übertreib’s nicht, sonst schicken wir dich doch noch fort, dann kannst du andern deine Schauermärchen aus der Zukunft erzählen.
Selmer (von abseits): Vielleicht hat er Recht?
Faske: Was weißt du denn schon, du Träumer?
Merten: Ruhig! Nicht streiten! Ich freue mich, daß ihr euch so etwas gar nicht vorstellen könnt. Der Fischfang ist nämlich ein Bild für die Gemeinde.
Loske: Hä?
Gulicke: Wie: „Bild“?
Merten: Na, man erzählt von einer Sache und meint damit eine andere, mit der es sich ähnlich verhält.
Jelatz: Versteh ich nicht!
Halatze: Warum erzählt man nicht gleich die andere?
Merten: Weil die vielleicht nicht ganz so leicht zu akzeptieren ist. Hört zu: Als die Jünger so viel gefangen haben, sind sie ganz erschrocken, weil sie erkennen, wie mächtig Jesus ist. Und Simon wirft sich zu seinen Füßen und sagt: Herr geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch.
Balyschk: Ja!
Merten: Aber Jesus geht nicht weg. Im Gegenteil. Er nimmt sie mit sich mit und sagt: Von nun an werdet ihr Menschen fischen.
Jander: Ui!
Merten: Ja, und deshalb ist es mit den Menschen wie mit den Fischen. Habe ich es richtig verstanden: Ihr würdet niemals Fische aus dem Netz zurück ins Meer werfen?
Die Fischer (tumultuös): Niemals! – Wie blöd kann man sein? – Der Loske vielleicht … – Jeder Fisch ist besser als nichts, wenn man Hunger hat! – Was die Götter, äh Gott geschenkt hat muß man achten!
Merten: Gut! Dann werdet ihr auch keinen Menschen aus eurer Gemeinschaft ausschließen oder jemanden wieder fortschicken, der zu eurer Gemeinschaft dazustoßen will!
(Die Fischer schauen Merten entgeistert an. Es ist totenstill.)
Faske (nach einer Weile): Aber welche von den Hevellern doch!
Gulicke: Genau, die Heveller aus dem Westen!
Tzizik: Aus Poztupimi! (schnaubt verächtlich)
Merten: Auch die Heveller nicht.
Balyschk: Aber die Sachsen und die Franken oder die … die Bajuwaren.
Jander: Na, von so weit wird schon keiner kommen!
Merten: Niemanden, der in friedlicher Absicht und vielleicht gar mit seiner Familie kommt. Ihr sollt keinen ausschließen! Jeder Mensch hat seinen ganz besonderen Wert.
(Die Fischer schauen vor sich hin, überlegen, kratzen mit einem Stock im Sand etc.)
Selmer (abseits): Oh Täler weit, oh Höhen, oh schöner grüner Wald!
Merten: Was singst du da, Selmer? Das ist hübsch!
Faske: Laß den! Der spinnt!
FORTSETZUNG FOLGT
Cornelie Becker-Lamers, Weimar